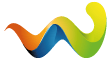Die Alte stand vornübergeneigt in den Zwiebeln. Sie wandte sich wie selbstvergessen um, nach einem Geräusch, einem Vogellaut. Gerade da fiel es ihr ein. Mit einem Mal, so leicht, wie ein Tautropfen vom Blatt gleitet, kam es ihr in den Sinn. Jetzt passte alles. Das Bild stand klar vor ihr, als hätte sie in blitzschneller Wendung die ganze Welt in einem Spiegel aufgefangen. Kein Zweifel: Hier auf dem Hof war ein Fremder.
Drei Zwiebelknollen in ihren Händen; feucht, kühl, lehmig und fremd. Mit einem Finger streifte sie Erdkrumen ab; die fielen unbeachtet zu Boden. Auf dem kurzen Weg vom Garten zum Haus schnurrte ihr eine Katze entgegen.
Endlich rückte alles zurecht. Hinter ihrem Rücken machte sich ein Eindringling zu schaffen. Doch wie sie so in einem fort dachte, stieß die Alte gleich wieder auf einen neuen Eimer quecksilbrig aufblinkenden Fragen. Die Katzen zum Beispiel. Sie schleckten die Milch nicht mehr von der Scherbe, sie drängten sich um die alte Schüssel. Wann war die ihr nur verloren gegangen? Von woher wieder ausgegraben? Und die zwei blaugefiederten Vögel. Sie nisteten unter dem Stalldach und waren doch längst über der Zeit. Es schien, als ob ständig einer der beiden in ihre Nähe hüpfte. Wollten ihr die zwei Gesellen ein ganzes Gesangbuch an traurigen Weisen lehren? Das waren geduldige und zugleich starrsinnige Lehrer. Und schließlich: der sauber gekehrte Platz vor dem Haus. Den querten von Mal zu Mal seltsame Fährten. Was kringelte da einer nachts in den Staub?
Viel länger, als ein Schößling braucht, um im Kirchhof bis zur Höhe der Dachgaube zu wachsen, um so vieles länger schon lebten Bauer und Bäuerin allein auf dem Hof.
Vor vielen Jahren, als man die Kilometersteine noch aus Granit schlug, war die breite Straße am Tal vorbei über die Hügel gezogen worden. Das Dorf lag seither wie am Rande der Welt. Das Gehöft fand sich noch ein gutes Stück weiter.
Drei Kinder hatte der Bauer an diesem vergessenen Ort gezeugt. Das erste in einer Winternacht, im Dunkel murmelnd, geschwätzig vor Glück. Das zweite an einem Märztag, weil die Sonne so hell gleißte. Und weil die Frau, ein violetter Schatten in der halb geöffneten Tür, weil damals die Frau ihn mit langem Blick hinein in das Haus sog. Beide Kinder blühten auf, spielten heiter, waren immer zufrieden, verstarben ganz plötzlich. So schnell, dass man hinterher nicht sagen konnte, welches der beiden zuerst. Oben im Wald zweigt ein Pfad ab zur Kuppe. Da liegen die zwei schon so lang nebeneinander. In einem umzäunten Karree. Das Kreuz mit den Namen berührt bald wieder die Erde.
Für das dritte Kind, einen Jungen, mußte der Bauer einen Abend, eine ganze Nacht lang flüstern, schmeicheln, betteln. Das Ungeborene trug sich nicht leicht. Es hüpfte und sprang schon im Bauch, als wollte es durchgehn. Nur hinaus in die Welt und dann fort.
"Immer fort", dachte die Alte, als sie abends Brot in die Suppe schnitt. "Immerzu fort."
Zwei Teller standen auf dem Tisch. Die Frau wartete, bis sich der Mann auf seinen Platz schob und rückte, dann erst gab sie den Schnittlauch auf. Wie alles hinab rieselte, immer so gleichmäßig fort. Jahr um Jahr fiel glatt durch ein Sieb. Was bleibt zurück? Schau selbst und schütt es dir nur in die Hand: Ein paar graue Steine.
"Da ist etwas mit dem Hof."
Der Alte horchte kaum auf, war mit sich selber beschäftigt. Die Frau erklärte: "Die blauen Vögel. Fliegen so frech in die Stube."
"Blau? Hast nie gesagt, dass sie blau sind", erwiderte der Alte.
"Und zwischen den Bohnen. Da versteckt sich ein Kraut. Das glimmert nachts. Hab‘s ausgerissen, gleich, wie ich’s sah. Aber es wächst immerzu nach. Hab dran gerochen. Davon gekostet. Da musst ich gleich den ganzen Tag weinen."
Der Alte wies stumm auf den Brotlaib; die Frau gehorchte. Wie sie die feuchtgraue Scheibe in Streifen schnitt, ein letzter Anlauf: "Gestern abend. War das Vieh plötzlich im Stall. Schon versorgt. Du warst so lang draußen im Wald. Ich hab drinnen Fisolen gezupft. Das Vieh. Das versorgt einer für uns."
Der Alte saß ganz klein, ganz in sich gesackt. In die Stube flossen Schatten und Stille ein wie dunkles Wasser. Der Bauer blieb stumm. Er nickte bisweilen am Tisch ein, noch vor dem letzten Bissen.
"Ich wollt gern wissen, was da ist auf dem Hof", durchschnitt die Bäuerin nach einer Weile das Dunkel.
"Ach, Weib", sagte endlich der Alte. " Das wird sie wohl sein. Das wird die Gute Frau vom Wald sein."
An diesem Abend hielten sich beide fest umschlungen. "Halt mich noch fester", sagte die Bäuerin. "Ich hab solche Angst".
"Ich hab Dich stets gehalten, so stark ich nur konnte. Das weißt du. Aber bald muss ich auslassen."
"Halt mich doch fester, immerzu fester. Lass mich nicht allein."
"Ach Frau. Meine Zeit ist gekommen. Die Gute Frau aus dem Wald zeigt es uns an."
"Lass mich nie los. Nie." So bat die Frau.
Die beiden saßen vor dem Haus, auf der Bank gleich neben der Treppe. Es wurde Nacht.
fortzetzung folgt